Der Artikel bezieht sich auf die Inhalte des "Monitor Gewalt gegen Frauen – Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland. Erster Periodischer Bericht" des Deutschen Instituts für Menschenrechte aus dem Jahr 2024.
Geschlechtsspezifische Gewalt stellt eine der gravierendsten Menschenrechtsverletzungen dar, die weltweit Frauen und Mädchen betreffen. In Deutschland wurde dieses Thema durch die Einführung der Istanbul-Konvention und die damit verbundene Berichterstattung erstmals auf eine umfassende und systematische Weise untersucht. Der erste periodische Bericht des Deutschen Instituts für Menschenrechte, der sich mit der Umsetzung dieser Konvention in Deutschland befasst, bietet erschreckende Einblicke in das Ausmaß geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Daten der Polizei sowie aus zivilgesellschaftlichen Organisationen zeichnen ein Bild, das nicht nur die Dringlichkeit des Themas unterstreicht, sondern auch die enormen Anstrengungen, die von Bund und Ländern unternommen werden müssen, um die Menschenrechte der Betroffenen zu schützen und durchzusetzen.
Zusammenfassung der Daten
 Diese Daten sind nur ein Auszug (Daten aus 2023) und beziehen sich auf das Hellfeld. Im Bericht finden sich viele wichtige Informationen und Statistiken zu diesem Thema.
Diese Daten sind nur ein Auszug (Daten aus 2023) und beziehen sich auf das Hellfeld. Im Bericht finden sich viele wichtige Informationen und Statistiken zu diesem Thema.
Zu den häufigsten Gewaltformen, von denen Frauen und Mädchen betroffen sind, gehören körperliche, psychische und sexualisierte Gewalt. Jeden Tag sind viele Frauen und Mädchen von körperlicher Gewalt betroffen, darunter auch zahlreiche Fälle von Femiziden. Ebenso erleiden täglich zahlreiche Frauen und Mädchen sexualisierte Gewalt, einschließlich einer erschreckend hohen Zahl an Vergewaltigungen.
85,7 Prozent aller Betroffenen sexualisierter Gewalt sind Frauen oder Mädchen. Beim Stalking sind es 79 Prozent. Bei psychischer Gewalt sind es fast 400 Opferwerdungen von Frauen und Mädchen pro Tag im Durchschnitt, darunter 55 im Bereich Stalking und 84 Nötigungen. Bei sexualisierter Gewalt werden im Durchschnitt täglich 171 Frauen und Mädchen Opfer. Darunter sind 32 Vergewaltigungen pro Tag. Geschlechtsspezifische Gewalt ereignet sich oft im direkten sozialen Umfeld. Bei vielen Gewaltformen war der Tatverdächtige den meisten Opfern bekannt. Bei Vergewaltigung kennen 76 Prozent der Opfer den Täter.
Der Monitor zur Gewalt gegen Frauen stellt fest: Zwischen 2019 und 2023 sind im polizeilichen Hellfeld bei zahlreichen Gewaltformen tendenziell Anstiege zu verzeichnen.
Die 2020 durchgeführte repräsentative Befragung „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“ (SKiD) des BKA und der Landespolizeien, an der 45.350 Personen teilnahmen, darunter 23.290 Frauen, ergab, dass 6 Prozent der Frauen ab 16 Jahren innerhalb von zwölf Monaten strafrechtlich relevante Sexualdelikte erlebten, 1,3 Prozent Körperverletzungen und 4,6 Prozent verbale Gewalt im Internet (Jahresprävalenz).
Wie die SKiD-Befragung zeigt, wird nur ein Teil der erlebten Gewalt von den Betroffenen bei der Polizei angezeigt. Die Anzeigequote für Körperverletzungen ist dabei generell höher als für Sexualdelikte, wobei sie mit zunehmender Schwere der Tat ebenfalls ansteigt. Im Detail bedeutet das: Im Durchschnitt zeigen Frauen 66 Prozent der an ihnen von einer einzelnen Person mit Waffe begangenen Körperverletzungen an. Bei sexualisierter Gewalt ist die Anzeigebereitschaft deutlich geringer.
Nur etwa jede zehnte Straftat im Bereich sexueller Missbrauch oder Vergewaltigung wird angezeigt.
Der Anteil der Frauen, die Kontakt zum Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ hatten, lag über die Jahre hinweg bei etwa 96 Prozent, der der Männer bei etwa 2 Prozent.
Ein Vergleich der Altersgruppen zeigt eine klare Tendenz, die auch bei vielen anderen Gewaltformen erkennbar ist: Besonders junge Frauen im Alter von 18 bis 20 Jahren sind in Bezug auf die Gesamtbevölkerung ihrer Alters- und Geschlechtergruppe am häufigsten von psychischer Gewalt betroffen. Frauen mittleren Alters (21 bis 59 Jahre) bilden zahlenmäßig die größte betroffene Gruppe. Hier liegt der Schwerpunkt auf Prävention, insbesondere bei Partnerschaftsgewalt. Frauen ab 60 Jahren sind zwar von allen Gewaltformen betroffen, leiden jedoch besonders unter körperlicher Gewalt – sogar stärker als bei Partnerschaftsgewalt. Für diese Gruppe sind spezielle Schutzkonzepte notwendig.
Zwischen 2019 und 2023 ist bei körperlicher Gewalt gegen Frauen eine Steigerung von 11,6 Prozent festzustellen. Die Tatverdächtigen setzten sich zu 34,7 Prozent aus Partnern, zu 12,3 Prozent aus Familienangehörigen oder anderen Verwandten und zu 18,1 Prozent aus Personen aus informellen sozialen Beziehungen wie Freundschaften zusammen. Von 2019 bis 2023 nahm polizeilich erfasste sexualisierte Gewalt kontinuierlich zu. Besonders junge Frauen im Alter von 18 bis 20 Jahren waren – im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil – am häufigsten von sexualisierter Gewalt betroffen. Bei 8,1 Prozent der Opfer waren Partner tatverdächtig, bei 6,4 Prozent Familienangehörige oder andere Verwandte.
Fast die Hälfte der weiblichen Opfer sexualisierter Gewalt kannte den Tatverdächtigen
Bei Vergewaltigungen waren fast ein Drittel der Tatverdächtigen Partner und 2,5 Prozent Familienangehörige oder sonstige Verwandte. Mehr als drei Viertel der weiblichen Opfer kannten den Tatverdächtigen.
Auch bei sexueller Belästigung sehen wir einen deutliche Anstieg im Beobachtungszeitraum.
Im polizeilichen Hellfeld wurden 134.098 Frauen und Mädchen im Jahr 2023 Opfer von Partnerschaftsgewalt – dies entspricht 367 Opferwerdungen pro Tag. Im Jahr 2023 waren fast 80 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt junge Mädchen und Frauen. Im Beobachtungszeitraum ist bei den häufigsten Formen der Partnerschaftsgewalt eine Zunahme der betroffenen Frauen und Mädchen zu verzeichnen. Dies betrifft psychische, körperliche und sexualisierte Gewalt sowie Gewalt, die auch oder überwiegend digital ausgeübt werden kann.
Zwischen 2019 und 2023 ist eine steigende Tendenz bei der Häufigkeit weiblicher Opfer innerfamiliärer Gewalt in den Bereichen psychische und körperliche Gewalt zu beobachten. Dies gilt auch für sexualisierte und digitale Gewalt, wobei die Anstiege aufgrund von Änderungen der Rechtslage nur eingeschränkt interpretiert werden können. Körperliche Gewalt stellt die häufigste Form der Gewalt dar, von der Frauen und Mädchen im Rahmen innerfamiliärer Gewalt betroffen waren.
Geschlechtsspezifische Gewalt tritt hauptsächlich im sozialen Nahbereich auf, wobei häufig Partner, Familienangehörige oder Personen aus informellen sozialen Beziehungen als Tatverdächtige identifiziert werden. Frauen und Mädchen aller Altersgruppen sind betroffen, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Besonders junge Frauen zwischen 18 und 21 Jahren sind stark betroffen, was die allgemein hohe Gewaltbelastung junger Menschen widerspiegelt. Ihre zahlreichen sozialen Kontakte schaffen vermehrt Tatgelegenheiten. Daher ist es wichtig, sichere Umgebungen für junge Frauen in öffentlichen Bereichen, Bildungseinrichtungen und im privaten Raum zu fördern sowie ihre Sensibilisierung und Selbstermächtigung zu stärken.
Diese Zahlen spiegeln nur die Spitze des Eisbergs wider. Aus der Dunkelfeldforschung ist bekannt, dass nur ein kleiner Teil der Straftaten in die offiziellen Statistiken gelangt, insbesondere bei Sexualdelikten.
"Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben frei von Gewalt. Die Istanbul-Konvention macht klar: Geschlechtsspezifische Gewalt ist eine Verletzung der Menschenwürde und der grundlegenden Menschenrechte. Der Schutz und die Unterstützung der Betroffenen ist nicht nur eine gesellschaftliche, sondern vor allem eine staatliche Pflicht und ein verbindlicher Rechtsanspruch.“ Müşerref Tanrıverdi, Leitung der Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt.
Quelle (Februar 2025) institut-fuer-menschenrechte.de
Rückblick auf das Jahr 2024
Anfang April 2025 wurde die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2024 vorgestellt. Schauen wir uns die Gewaltkriminalität an, sehen wir einen Anstieg um 1,5 Prozent auf über 217.000 Fälle. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betont "Der Schutz von Frauen vor Gewalt muss auch für die nächste Bundesregierung eine zentrale Aufgabe sein". Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und Übergriffe haben in Deutschland stark zugenommen. Es sind 2024 1.134 Fälle mehr als im Jahr 2023. Insgesamt waren es 2024 13.320 Straftaten in diesem Bereich. Das sind 9,3 Prozent mehr als im Jahr 2023 mit 12.186 Sexualdelikten.
Gegenwehr und Erfolg
In verschiedenen Studien aus den 80ern und 90ern zur Gegenwehr von Frauen gegen Übergriffe zeigt sich, dass ein hoher Prozentsatz von Frauen versucht, sich zu wehren: In der internen Studie des PP Bielefeld wehrten sich 60 Prozent, in der Studie der Polizeidirektion Hannover 67 Prozent, und in einer neuen Studie 86 Prozent der Frauen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Opfer, die sich nicht gegen die Gewalt wehrten, die Gewalt weniger wahrscheinlich zur Anzeige bringen. Da es sich bei den genannten Zahlen um eine Auswertung des Hellfelds handelt, dürfte der Prozentsatz der Gegenwehr in der Realität, also mit Einbezug des Dunkelfeldes, niedriger liegen.
Die Analyse von Studien zeigt, dass der direkte Transfer von erlernten Selbstverteidigungsfähigkeiten in reale Gewaltsituationen unsicher ist, da die Übertragbarkeit der gelernten Techniken in authentische Szenarien komplex ist. Dennoch weisen Studien wie die von Caignon und Groves darauf hin, dass eine aktive Verteidigungshaltung in gefährlichen Situationen die Sicherheit erhöhen kann. Personen, die sich aktiv wehren, haben nach diesen Studien eine höhere Wahrscheinlichkeit, Gewaltsituationen zu unterbrechen oder zu überstehen.
Brecklin und Ullman (2005) zeigen, dass Personen, die Selbstverteidigungstraining absolvierten, oft angaben, dass ihr Widerstand Gewalt stoppte und sie weniger Angst und mehr Wut zeigten, was ihre Verteidigungskraft verstärkte. Auch ohne direkte Übertragung der Trainingsinhalte trägt das Training dazu bei, dass sich die Teilnehmer sicherer verhalten und sich besser durchsetzen können.
Fraser und Russell (2000) berichten, dass Selbstverteidigungskurse auch positive Nebeneffekte wie eine gesteigerte Durchsetzungsfähigkeit und veränderte Selbstwahrnehmung bei Frauen haben. Selbstverteidigungstraining fördert somit nicht nur den physischen Schutz, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung.
In "Sicherheit und Kriminalität in Deutschland – SKiD 2020" lesen wir auf Seite 150: "Die am seltensten umgesetzte konkrete Vorsichtsmaßnahme in der Bevölkerung ist das Betreiben von Selbstverteidigungstraining und/oder Kampfsport, lediglich 3,7 % nutzen diese Maßnahme regelmäßig."
Wing Chun als Selbstverteidigung
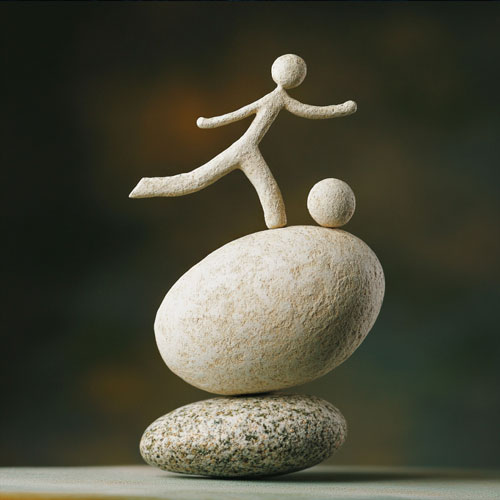 Studien weisen also darauf hin, dass Selbstverteidigungskurse wirksam sind und dass es wichtig ist, diese zugänglich und qualitativ hochwertig zu gestalten. Die Idee, Wing Chun als Selbstverteidigungssystem zu verwenden, erscheint ebenfalls sinnvoll. Denn Wing Chun basiert auf Prinzipien und nicht nur auf festen Techniken, was es den Praktizierenden ermöglicht, sich flexibel an unterschiedliche Angriffssituationen anzupassen. Diese Herangehensweise fördert intuitives Handeln, was in realen Notwehrsituationen von Vorteil sein kann.
Studien weisen also darauf hin, dass Selbstverteidigungskurse wirksam sind und dass es wichtig ist, diese zugänglich und qualitativ hochwertig zu gestalten. Die Idee, Wing Chun als Selbstverteidigungssystem zu verwenden, erscheint ebenfalls sinnvoll. Denn Wing Chun basiert auf Prinzipien und nicht nur auf festen Techniken, was es den Praktizierenden ermöglicht, sich flexibel an unterschiedliche Angriffssituationen anzupassen. Diese Herangehensweise fördert intuitives Handeln, was in realen Notwehrsituationen von Vorteil sein kann.
Die Betonung auf Körpergefühl, Balance, Distanz und Timing ist besonders wichtig, da diese Fähigkeiten die Grundlage für eine effektive Selbstverteidigung bilden. In einer echten Auseinandersetzung sind diese Faktoren oft entscheidender als das Erlernen komplizierter Techniken. Die Einfachheit der angewendeten Techniken in Wing Chun ermöglicht es den Trainierenden, sie in stressigen Momenten leichter anzuwenden. Allerdings ist es auch so, dass kontinuierliches Üben erforderlich ist, um diese Prinzipien in einer echten Bedrohungssituation effektiv einsetzen zu können. Wenn also oben von unsicherem Transfer gesprochen wird, stellt sich die Frage, wie lange und intensiv die Personen Kampfsport trainiert haben und welche Stile sie dabei praktizierten.
Insgesamt scheint Wing Chun als Selbstverteidigungssystem eine gute Wahl zu sein, da es die notwendigen körperlichen und mentalen Fertigkeiten trainiert und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität bei der Anwendung von Techniken bietet. Das regelmäßige Wing-Chun-Training sollte jedoch um einige Kurse in Judo oder BJJ ergänzt werden, da im traditionellen Wing Chun weder eine Fallschule stattfindet noch Bodenkampf ein Bestandteil ist. Auch wenn man in einer realen Notsituation nicht freiwillig auf einen steinigen Boden fällt und sich daher auch nicht absichtlich in einen Bodenkampf begibt, sollten grundlegende Fähigkeiten dazu vorhanden sein. Grundsätzlich sollte festgehalten werden, dass die Übertragbarkeit von Verteidigungskonzepten auf Notsituationen mit der Dauer des Trainings und der Realitätsnähe der erlernten Ideen zunimmt. Ein Schnupperkurs oder eine Wendo-Veranstaltung ist auf jeden Fall besser als nichts. Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass dies nur der Anfang sein kann. Wer sich wirklich sicher fühlen möchte, muss regelmäßig trainieren und die erlernten Fähigkeiten vertiefen.
Abgesehen davon erleidet jeder dritte Mensch über 60 jährlich einen Sturz, wobei jeder zehnte Sturz zu Verletzungen führt, die oft schwerwiegende Folgen haben, einschließlich Todesfällen. Seit 1990 nimmt die Zahl der Todesfälle und der verlorenen gesunden Lebensjahre (DALY) durch Stürze in Europa kontinuierlich zu. Kampfsporttraining, Fallschule usw. fördern die Beweglichkeit im Alter, verbessern das Körpergefühl, verbessern die Zeiten beim "Timed Up and Go"-Test und vieles mehr. Kurzum: regelmäßiges Kampfsporttraining hilft in vielen Notsituationen. Im Saarland und Saarbrücken gibt es diverse Kurse, Schulen und Angebote dazu.
Die Eskalations-Treppe runter steigen
 All das oben Beschriebene behandelt Notsituationen. Doch bevor es zu einer Notsituation kommt, in der man Notwehr anwenden kann, gilt es, konfliktbeladene Situationen zu deeskalieren oder gefährliche Orte zu meiden. Da die Themen Eskalation und Deeskalation / Konfliktmanagement und Selbstbehauptung von großer Bedeutung sind, findet ihr in diesem Bereich weitere Texte zu diesen Themen.
All das oben Beschriebene behandelt Notsituationen. Doch bevor es zu einer Notsituation kommt, in der man Notwehr anwenden kann, gilt es, konfliktbeladene Situationen zu deeskalieren oder gefährliche Orte zu meiden. Da die Themen Eskalation und Deeskalation / Konfliktmanagement und Selbstbehauptung von großer Bedeutung sind, findet ihr in diesem Bereich weitere Texte zu diesen Themen.
Für Kontakte im Saarland zum Thema Gewalt an Frauen siehe hier.

